ZEIT 03.06.2021 /// Kunst von der "Drushba"-Trasse in Eisenhüttenstadt
Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Kunstwerke, die während des Baus der sowjetischen Erdgastrasse «Sojus» in den 1970er und 1980er Jahren entstanden waren, werden ab Sonntag (6.6./14 Uhr) in einer neuen Ausstellung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gezeigt. Benannt ist die Schau nach dem Trassen-Abschnitt «Drushba» (deutsch: Freundschaft) in der heutigen Ukraine, für dessen Bau die DDR damals zuständig war. Die Ausstellung ist Teil der Kampagne «Kulturland Brandenburg», die sich in diesem Jahr der Industriekultur widmet.
Organisiert von der Freien Deutschen Jugend (FDJ) waren Tausende Arbeiter und Ingenieure über Jahre an der Erdgastrasse im Einsatz. Von der DDR-Führung als «Jahrhundertprojekt» deklariert, wurde der Trassenbau von einer großangelegten Kulturkampagne begleitet, um die «Trasniks» genannten Bauarbeiter zu unterhalten und ihr Wirken zu dokumentieren.
Nicht nur Autoren und Musiker besuchten die Trasse, sondern auch bildende Künstler. Viele der damals entstandenen Gemälde, Grafiken, Fotografien und Zeichnungen sind heute Teil des Kunstarchives Beeskow (Oder-Spree). Eine Auswahl dieser Arbeiten wird ab Sonntag in der ersten Selbstbedienungskaufhalle gezeigt, die 1957/58 in der am Reißbrett entstandenen sozialistischen Stadt Eisenhüttenstadt gebaut worden war.
© dpa-infocom, dpa:210603-99-842801/2
Artikel auf ZEIT online lesen >>>

Sabrina Kotzian, Kuratorin der Ausstellung über die einstige Kulturkampagne der DDR zum Bau der Erdgastrasse «Freundschaft» (russisch Drushba), hockt hinter einer alten Ausstellungskiste.
Bild: Wolfgang Liebert / Foto: © Patrick Pleul
PNN 07.12.2020 /// Künstlerische Reflexionen um 1990 / Als die Zeit Kopf stand
Alles war bereit, dann kam der Lockdown: Seitdem wartet die Ausstellung "Alles ist möglich" im Potsdamer Museumshaus Im Güldenen Arm auf ihren Auftritt. Zum Glück kann man sie wenigstens digital besuchen.
In Ost und West gab es Neues zu verarbeiten
Die Ausstellung will ausdrücklich nicht nur ostdeutsche Kunst zeigen, nicht nach Herkunft sortieren. Die These, die dahinter steht: Für Künstler auf beiden Seiten der ehemaligen Mauer gab es 1990 Neues zu verarbeiten. Und noch etwas zeigt dieses Nebeneinander, das nicht in Ost oder West unterscheidet: Wer meint, über die Kunst die Herkunft ableiten zu können, verrennt sich schnell. Nicht aller Realismus ist gleich Ost, nicht alle Konzeptkunst gleich West.
Zu sehen sind neben Aratoras Arbeiten jene von den Potsdamern Barbara Raetsch, Karl Raetsch, Wolfgang Liebert und dem gebürtigen Hagener Axel Gundrum sowie von den Westberlinern Matthias Koeppel und Ernst Leonhardt. Frank W. Weber leitet die Stadtgalerie Kunst-Geschoss in Werder an der Havel, daher kennt er die anderen Künstler. Wolfgang Liebert, dessen Ansichten des Holländischen Viertels vor Kurzem im Jan Bouman Haus zu sehen waren, zeigt sich hier von anderer Seite: drei Stillleben des neuen Überangebots aus den frühen 1990er Jahren, abgerundet durch Ergänzungen aus späterer Zeit.

Ausschnitt: "Stillleben mit gerupften Huhn" schuf der Potsdamer Maler Wolfgang Liebert zwischen 1992 und 2020 / Foto: Ottmar Winter
PNN 15.05.2020 /// Wolfgang Liebert im Jan Bouman Haus
Corona hat unseren Blick verändert. An Ausstellungen wie "Königsland" kann man diesen Blick testen, und muss gleichzeitig anerkennen: Es gibt noch so viel anderes als Corona. Auch davon erzählen die Fotos. Von Armut, Hunger, ganzen Vorstellungswelten, von denen wir hier in Europa keine Ahnung haben. Das erdet. Auch darum ist es so zu begrüßen, dass die hiesige Kultur wieder in Schwung kommt. Sie hilft, mehr zu sehen als das, was man tagtäglich sieht. Hilft, mehr zu sehen als sich selbst.
Auch das Jan Bouman Haus im Holländischen Viertel lenkt den Blick weg vom unmittelbaren Jetzt. Ab Samstag, dem 16. Mai ist im durchsanierten Museumsbau wieder das Viertel zu sehen, wie es einst aussah. Gezeigt werden Werke aus den Jahren 1986 bis 1991 von dem Potsdamer Maler Wolfgang Liebert. "Dinge, die gelebtes Leben zeigen, sind interessanter", sagte Liebert einmal, und solche "gelebten Dinge" sind auch die Sujets dieser Schau: das noch unsanierte Holländische Viertel aus den Jahren vor und kurz nach der Wende. Zwei Haushalte sind in dem Ausstellungsraum zugelassen.
Damals war das Viertel alles andere als ein Touristenziel, die Stadt hatte sich sogar mit dem Gedanken getragen, es völlig abzureißen. Bis der Architekt Christian Wendland 1974 zeigte, wie so ein saniertes Holländisches Haus aussehen konnte. Damit waren die Abrisspläne vom Tisch - was die Stadtverwaltung nicht davon abhielt, noch 1988 ein von Jan Bouman entworfenes, von Stararchitekt Knobelsdorff errichtetes Haus neben der Französischen Kirche abzureißen.
Wolfgang Liebert hat das Gebäude gemalt, kurz dem Abriss. Im Hintergrund gluckt schon das neue Klinikgenäude, für dessen Hubschrauberlandeplatz das Holländerhaus damals weichen musste. Der Himmel darüber ist bedrohlich grau. "Aber Wut war damals kein Impuls für mich beim Malen", sagt Wolfgang Liebert. "Eher der liebende, humanistische Blick des Bewahrens." Liebert, 1944 in Westpreußen geboren, lebt seit 1949 in Potsdam. Hier besuchte er als Kind die Eisenhartschule, später das Helmholtz Gymnasium. Das Holländische Viertel querte er hundertfach, er ist ihm, wie er selbst sagt, in "tiefer Zuneigung verbunden."

Foto: Andreas Klaer, PNN
MAZ 28.09.2019 /// Retrospektive zeigt Wolfgang Lieberts Bilder aus mehr als 50 Jahren
Die Stadtgalerie Werder zeigt eine Retrospektive des Potsdamer Maler Wolfgang Liebert. Er entdeckt auch mit seiner Malerei auch seine westpreußische Heimat wieder.
Werder
Betritt man die neue Ausstellung in der Stadtgalerie Werder, sieht man sich dem „Persius-Speicher im Winter“ gegenüber. Schnee und Eis scheinen die Farbe des markanten Bauwerks in der Potsdamer Zeppelinstraße gebleicht zu haben. Als hätte Väterchen Frost Haus und Hof angehaucht. Ganz unterschiedliche Motive aus der Stadt, in der er seit Kindertagen zu Hause ist, zeigt der Potsdamer Maler Wolfgang Liebert in der Retrospektive seines Schaffens, die noch bis zum 3. November im Kunstgeschoss des Werderaner Schützenhauses zu sehen ist.
Student an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee
Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Liebert, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feierte, künstlerisch unterwegs. Die ältesten Bilder, die in Werder gezeigt werden, entstanden in den 1960er Jahren. Da war er gerade Student an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee geworden. Es sind neben Porträts seiner Mutter und seines Großvaters unter anderem eine Ansicht der Dorfstraße von Sputendorf oder ein Obstgarten in Golm. In den 1980ern dokumentierte der Künstler im Holländischen Viertel sowie in der Gutenbergstraße den Verfall des alten Stadtzentrums. Die Überzahl der ausgestellten Potsdam-Ansichten malte Liebert jedoch im 21. Jahrhundert, z.B. in und um Sanssouci, am Pfingstberg mit dem Jüdischen Friedhof, an der russisch-orthodoxen Kirche der Kolonie Alexandrowka.
Melancholisches und Märchenhaftes
Jenseits der Oder im damaligen Westpreußen ist Wolfgang Liebert 1944 geboren worden. Diesem Gebiet im heutigen Polen, in dem seine Familie einst lebte und das er noch vor seinem ersten Geburtstag verlassen musste, näherte er sich in den zurückliegenden Jahren an, wie zahlreiche Bilder zeigen. Sie deuten auf eine liebevolle Annäherung sowohl zu den Menschen als auch der Landschaft hin. Da finden sich Melancholisches wie der „Bahnhof ohne Ankunft“ oder der „Bahnhof ohne Wiederkehr“, Natur- und Landschaftsmalerei wie der herbstliche Blick auf „Jadwigas Garten“ aber auch Fantasievolles wie die „Sternennacht im August - Roscin“ oder „Roscin - Augustnacht am verlassenen Bahnhof“. Diese beiden scheinen einem wunderbaren Märchenbuch entschlüpft zu sein.
Ausstellung läuft noch bis zum 3. November
Vor Lieberts „Der neue Turmbau zu Babel – Apokalypse“ aus dem Jahr 2015 kann man lange verweilen. Wie viele Katastrophen der Menschheitsgeschichte hat der Künstler in diesem verwinkelten Turm versteckt? Man findet die Kreuzigung Jesu, die Reste antiker Krieger, das trojanische Pferd, den Stier aus Picassos Antikriegsbild „Guernica“ und so viel mehr. Unterhalb des Turms versucht ein Boot, vollbesetzt mit Menschen, das rettende Gemäuer zu erreichen und verbindet dabei die historischen Ereignisse mit unserer Gegenwart. Das Gemälde ist für die Ausstellung von einem Sammler ausgeliehen.
Mitunter verblüfft Wolfgang Liebert durch Wechsel im Stil. Neben sehr detailreichen Darstellungen von Natur und Stadt hängen Landschaften, die aus strukturierten Flächen komponiert sind.
Die Wolfgang-Liebert-Retrospektive ist bis zum 3. November in der Stadtgalerie Werder, Uferstraße 10, donnertags, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr zu sehen.
Von Edith Mende


MAZ 10.05.2019 /// Kunstgespräch in der „Guten Stube“
Der Potsdamer Kunstverein zeigt in der Ausstellungsreihe „parallel“ frühe Arbeiten von Wolfgang Liebert und seiner Lehrerin Suse Globisch-Ahlgrimm.
Innenstadt
Der Potsdamer Kunstverein lädt am Sonnabend um 16 Uhr zu einem Ausstellungsgespräch mit dem Potsdamer Künstler Wolfgang Liebert und dem Kurator Thomas Kumlehn in die Galerie „Gute Stube“ in der Charlottenstraße 121 ein. Gezeigt werden in der aktuellen Ausstellung, die noch bis zum 1. Juli zu sehen ist, Zeichnungen aus dem Nachlass von Suse Globisch Ahlgrimm (1920-2012) sowie Malerei und Grafik von Wolfgang Liebert (*1944).
Vorgestellt werden hauptsächlich Malerei und Zeichnungen von Potsdamer und Babelsberger Stadtansichten. Wolfgang Liebert zeigt vorwiegend Bilder aus dem Frühwerk (1959-1963), als er die Erweiterte Oberschule 4 (heute Helmholtz-Gymnasium) besuchte und Schüler von Suse Globisch-Ahlgrimm war. Von ihr, die bis 1983 in Babelsberg gewohnt hat, sind Zeichnungen aus den 1970er und 1980er Jahren zu sehen.

PNN 13.10.2014 /// „Für mich ist das Belvedere ein sehr vielschichtiger Ort“
„Für mich ist das Belvedere ein sehr vielschichtiger Ort“
Wolfgang Liebert spricht im PNN-Interview über das Potsdam seiner Kindheit, das Malen in und von dieser Stadt und darüber, warum Potsdam trotzdem nicht zu seiner Heimat wurde
In der Ausstellung „Stadt-Bild/Kunst-Raum“ zeigt das Potsdam Museum anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls erstmalig Werke aus der hauseigenen Sammlung mit Kunst aus der Zeit der DDR, darunter auch zahlreiche Arbeiten von Potsdamer Künstlern zum Thema Stadt. Die PNN befragen einige dieser Potsdamer Künstlerinnen und Künstler zu ihren Werken, ihrem Verhältnis zu dieser Stadt und ihrem Dasein als Künstler in der DDR. Nach Barbara Raetsch und Peter Rohn kommt nun der Maler Wolfgang Liebert zu Wort.
Herr Liebert, zwischen 1986 und 87 entstand Ihr Gemälde „Paar im Belvedere“ auf dem Pfingstberg, also an einem Ort, der im Grunde eine verbotene Zone war.
Das Gelände unterhalb des Pfingstbergs war damals die verbotene Zone, also das sogenannte KGB-Städtchen, das umzäunt war.
Dieses KGB-Städtchen, was für ein Ort war das für Sie?
Für mich persönlich hat das eine ganz eigene Geschichte. Ich bin in der Berliner Vorstadt, in der Rembrandtstraße aufgewachsen, also drei Straßen vor der Glienicker Brücke. Die Villa Schöningen war da noch ein Kindergarten, in den ich gegangen bin. Diese ganze Gegend dort um den Heiligen See war der Spielplatz meiner Freunde und von mir. Damals wurde der Heilige See noch der Russische See genannt. Es gab dort mehrere Badestellen, an denen auch russische Offiziersfamilien badeten. Das war zwar etwas Fremdes, für uns aber selbstverständlich, denn wir sind da ja hineingewachsen. Und als 1953 Stalin starb, da war ich neun Jahre alt, haben wir uns nur über diese großen Plakate gewundert, diese Trauer und diese merkwürdige Stimmung, die auch in Potsdam herrschte. In der Menzelstraße gab es einen russischen Sender, im Neuen Garten waren sogar Lautsprecher aufgestellt und so hörten wir die Musik und die russischen Nachrichten von Radio Moskau.
Hat Sie das überhaupt nicht beunruhigt?
Nein, wir haben uns auch nicht gefürchtet. Für uns gehörte das einfach dazu. Nun muss man auch wissen, dass es in der Nachkriegszeit einige Ruinen in der Berliner Vorstadt gab, in denen wir auch spielten. So haben wir die Orte entdeckt, auch das Belvedere auf dem Pfingstberg. Ein geheimnisvoller Ort, damals größtenteils schon eine Ruine, die im Laufe der Jahre immer mehr verfiel. Dadurch hatte es auch etwas Romantisches, wie ein altes, verfallenes Schloss. Das da etwas unwiederbringlich verfallen könnte, das habe ich in dem Alter nicht gesehen. Für mich war das ein einziges Abenteuer.
Aber auch später hat Sie dieser Ort nicht losgelassen.
Nein, und nicht nur dieser. Auch während meines Studiums in Berlin bin ich immer in Potsdam geblieben. An der Alten Fahrt hatte ich ein Atelier. Und dort, wo heute alles neu entsteht, habe ich noch die Ruinen gesehen und diese auch gemalt. Dabei ist eine ganze Serie von Gemälden entstanden, die sich jetzt in der Stiftung Stadtmuseum in Berlin befinden. In den 80er-Jahren habe ich mich dann auch intensiv mit dem Holländischen Viertel beschäftigt. Dort habe ich künstlerisch-dokumentarisch in den verschiedenen Quatieren, Hausdurchgängen und selbst in Treppenaufgängen gearbeitet. Dabei ist eine Serie von über 100 Arbeiten entstanden.
Die Potsdamer Malerin Barbara Raetsch, die auch in dieser Ausstellung zu sehen ist, hat den Verfall des Holländischen Viertels in den 80er-Jahren zu einem künstlerischen Lebensthema gemacht. Wie haben Sie diese Entwicklung gesehen?
Das war natürlich ein Drama. Da gab es viele leere Wohnungen, da rollten sich die nassen Tapeten von den Wänden. Auch wenn das jetzt etwas komisch klingen mag, aber künstlerisch war das eine Sensation, so etwas malen zu können. Einmal habe ich sogar miterlebt, wie ein Haus in der Mittelstraße abgerissen wurde. Da stand die Feuerwehr mit einem großen Schlauch, weil das so staubte. Diese großen Abrissbirnen krachten dann in die Fassade, bis die zusammenfiel. Da waren dann noch Möbel in den Wohnungen, die mit herunterstürzten. Ich bin dann auf die andere Straßenseite und habe im Haus gegenüber gefragt, ob ich das zeichnen könnte. Dann saß ich am obersten Fenster und habe gemalt. Künstlerisch war das spannend, auf der anderen Seite aber war da dieser Verlust. Das war schon bitter. Ich war damals an der Fachschule, der heutigen Fachhochschule, als Dozent beschäftigt und bin mit den Studenten der Restaurierung auch oft ins Holländische Viertel gegangen. Dort haben wir gezeichnet, maltechnische Übungen gemacht.
Auch auf dem Pfingstberg?
Ja, dort auch.
Und in dieser Zeit hatten Sie die Idee für das Gemälde „Paar im Belvedere“?
Die ist direkt vor Ort entstanden.
Sie haben in der Ruine selbst gemalt?
Ja, der Zugang war zwar durch schwere Eisentüren versperrt, aber in die Rückseite des Belvederes war ein Loch gesprengt, durch das ich gerade so hindurchpasste. Ich hatte dann die Idee, dort oben zwischen dem östlichen und westlichen Turm zu malen. Ich hatte meine Feldstaffelei und diese große Leinwand mitgenommen und habe das unten zusammen mit dem Farbkoffer abgestellt. Mit einem Seil bin ich dann durch das Loch geklettert, über die maroden Stufen nach oben gegangen, habe dort das Seil angebunden und ein Ende nach unten geworfen. Dann bin ich wieder runter, habe alles angebunden, wieder nach oben und alles hochgezogen. Dann habe ich wie im Plenair gearbeitet, das Bild zuerst angelegt und mich für die zeichnerische und die Farbkomposition entschieden.
Was war das Belvedere zu diesem Zeitpunkt für ein Ort?
Ich würde schon sagen, dass es ein Ort war, an dem sich Menschen trafen, die etwas außerhalb der Gesellschaft standen. So konnte man von einem der Türme im Juni, wenn im Wannsee Regatta war, bei schönem Wetter die Segel sehen.
Das Belvedere als Sehnsuchtsort?
Das auf jeden Fall. Aber es war auch ein trauriger, ein dramatischer Ort. Denn dort ist mal ein junger Mann abgestürzt. Da waren ja überall Graffitis in deutscher, englischer und kyrillischer Schrift. Manchmal auch an Stellen, da hat man sich schon gefragt, wie die da hingekommen sind. Für mich hatte das Belvedere vor allem etwas Melancholisches. Es war, weil es etwas abseits lag, auch ein Rückzugsort. Und vor allem künstlerisch war es hochinteressant.
Weil der Zerfall reizvoller ist als das Neue?
Es muss nicht immer der Verfall sein, aber Dinge, die gelebtes Leben zeigen, sind interessanter. Das sieht man sehr gut an rekonstruierten Häusern, wenn die Farbe noch keine Patina hat, wirkt das einfach kalt. Die Asiaten sprechen hier von der Schönheit des Gelebten.
Das Paar, das Sie auf dem Bild zeigen, hat eine gewisse Punk-Attitüde. Ein eindeutiges Zeichen, dass die beiden sich abgrenzen wollen. Ist dieses Gemälde als eine Art Protest oder Kritik zu verstehen?
Ich habe dieses Bild nicht gemalt, weil ich wütend war. Ich habe es gemalt, weil dieser Ort eine Bedeutung für mich hat. Und natürlich spricht da auch eine gewisse Sehnsucht. Aber für mich ist dieses Belvedere ein sehr vielschichtiger Ort, was auch mit meiner Kindheit und meinen Erfahrungen zu tun hat.
Ein Ort, eine Ruine, in der man nur für eine gewisse Zeit verweilen kann.
Ja, durch das Bild fliegt auch ein Stück Zeitung, was eine gewisse Lesbarkeit bedeuten kann.
Wie die zerdrückte Coca-Cola-Dose und der Kassettenrekorder?
Es gibt drei oder vier Bilder, auf denen ich eine solche Cola-Dose gemalt habe. Übrigens, schwer zu malen, eine solche zerdrückte Dose. Und natürlich ist das ein Symbol, in dem eine starke Sehnsucht zum Ausdruck kommt, die ja nicht allein darin besteht, eine solche Cola trinken zu wollen. Wie bei dem Kassettenrekorder, der ja auch von dem Wunsch spricht, nicht nur staatlich verordnete Musik hören zu wollen.
Haben Sie das Bild in der DDR ausgestellt?
Ich habe es versucht und für eine Ausstellung eingereicht. Es wurde aber abgelehnt.
War der Westen, die Bundesrepublik für Sie ein Sehnsuchtsort?
Nein, denn ich habe mich nie unfrei gefühlt. In den 50er-Jahren bin ich ein Jahr in der alten Bundesrepublik zur Schule gegangen. Mein Vater lebt in der Nähe von Kassel. Und dort habe ich den ganzen Mief der 50er-Jahre kennengelernt. Und auch diese Lehrer, die teilweise noch aus der Nazizeit kamen. Wenn man Lieder von Franz Josef Degenhardt hört, wie beispielsweise „Deutscher Sonntag“, da ist das alles treffend beschrieben. Später hatte ich dann auch zweimal ein Visum zu Ausstellungen nach Westberlin. In Drewitz bin ich in den Bus gestiegen und am Abend über Wannsee wieder zurückgekommen. In einer Kneipe in Wannsee habe ich noch eine Bockwurst gegessen. Dort saßen dann ein paar Männer am Tisch, nicht mehr ganz nüchtern, die haben zu mir gesagt: „Hey du, wenn du wieder rüberkommst, hau dem Honecker von uns mal ordentlich auf die Fresse.“ Ich hatte mich gut angezogen. Aber die haben erkannt, dass ich aus der DDR komme. Ich hätte natürlich drüben bleiben können, aber den Gedanken hatte ich nicht.
Wie haben Sie den Fall der Mauer erlebt?
Mit einer gewissen Zurückhaltung. Ich bin nicht zur Glienicker Brücke gelaufen, als die offen war. Aber ich erinnere mich daran, dass meine Studenten gesagt haben: „Herr Liebert, wir sind mal ne Stunde weg und holen uns eine Tüte.“ An der Glienicker Brücke standen die großen Trucks von Kaisers und haben Tüten mit Kaffee und Schokolade verteilt. Danach sind sie dann wiedergekommen und haben weitergearbeitet.
Was hat für Sie die Wende 89 bedeutet?
Neben den erfahrenen Verlusten und Erkenntnissen danach habe ich vor allem meine geistige Unabhängigkeit erlangt. Das ist natürlich etwas Großes.
Von welchen Verlusten sprechen Sie?
1989 waren vielen Arbeiten von mir in Ausstellungen unterwegs. Nicht nur in Ateliers, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen. Durch diesen Umbruch sind viele dieser Werke einfach verschwunden, gestohlen worden. Dann habe ich schon kurz nach der Wende mein Atelier an der Alten Fahrt verloren, weil die Häuser zu Wohnungen umgebaut wurden und ich die Miete nicht mehr zahlen konnte. Dann folgte eine Umstrukturierung der Fachschule in eine Fachhochschule, bei der auch Stellen reduziert wurden. So habe ich 1996 meinen Arbeitsplatz verloren. Mein Hauptthema war natürlich die Malerei. Ich hatte keine Vollzeitstelle, aber der Verlust hat mich trotzdem getroffen. Auch familiär kam es zu Brüchen. Es war schon eine Zeit des Durchhaltens. Ich habe in dieser Zeit im Besucherservice der Schlösserstiftung gearbeitet und für einen Mosaiksetzer in der Friedenskirche die Fußböden in den Kreuzgängen mit erneuert, gemauert. Eine harte Arbeit. Dort haben mich dann Leute getroffen und ganz erstaunt gefragt: „Herr Liebert, was machen Sie den hier? Ich denke, Sie sind Maler?“
Haben sich diese Einschnitte auf Ihre Art zu malen ausgewirkt?
Nein, es hat sich zwar etwas geändert. Aber insgesamt ist es schwieriger geworden.
Sie sind in Potsdam zwar nicht geboren, aber groß geworden und haben hier Ihr Leben verbracht. Was bedeutet Ihnen diese Stadt?
Das ist eine Frage, über die ich schon oft nachgedacht habe. Und da muss ich immer an meinen Großvater denken, der über 80 Jahre alt geworden ist. Der hat die Kaiserzeit und den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Dann der Verlust der Heimat. Und er kam mit nichts hier her, lebte zuerst in Zeitz in einem Industriegebiet in einer alten Werkstatt. Das war furchtbar. Bis ihn meine Mutter nach Potsdam holte. Das hat mich immer stark beschäftigt. Und so war das Malen für mich im psychologischen Sinne eine Sublimation, um schwierige Situationen positiv zu überstehen. Kunst ist, nach Sigmund Freud, die positivste Form der Sublimation.
Ist Potsdam mit der Zeit mehr als nur eine künstlerische Heimat geworden?
Das ist schwierig zu beantworten. Wenn man von meinen Bildern ausgeht, beschäftigen sich viele mit Potsdam, weil das mein Lebensraum ist. Aber nach der Wende ist meine Mutter mit mir in die alte Heimat gefahren, die Gegend zwischen Stettin und Landsberg an der Warthe, und hat mir dort alles gezeigt, wo mein Großvater seinen Bauernhof hatte. Dort habe ich mir einen Garten angelegt. Und ich habe gemerkt, wenn ich dort in der Erde grabe, was anlege und pflanze, das ist so ähnlich wie das Malen. Da habe ich dann auch Heimat gespürt. Mit Potsdam ist das anders. Hier finde ich etwas vor, das ich annehme und künstlerisch als großartig empfinde. Und natürlich sehe ich, wie schön es hier ist. Aber, um es etwas bildlicher auszudrücken, Potsdam ist nicht meine Mutter. Denn die Mutter sieht man nicht immer im Festkleid, sondern auch mal in der Schürze und mit ungewaschenen Haaren. Aber es bleibt die Mutter und man liebt sie.
Das Gespräch führte Dirk Becker
Wolfgang Liebert, geb. 1944 in Meseritz (Pommern), war Mitglied im Caputher Malzirkel von Magnus Zeller, studierte an der Kunsthochschule Berlin und lebt seit seiner Kindheit in Potsdam..


MAZ 02.04.2012 /// “Eiszeit” im Städtischen Museum
Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend zeigte sich das Städtische Museum in der Löwenstraße im Ortsteil Fürstenberg (Oder) nicht nur eingerüstet, sondern auch noch ziemlich belebt. Mit einem weinenden Auge wegen der Kultusausschusssitzung und mit einem lachenden Auge wegen der ersten großen Ausstellungseröffnung in diesem Jahr stellte Museumsleiter Hartmut Preuß den Maler Wolfgang Liebert vor. Im Kontakt mit dem Publikum: Wolfgang Liebert vor einem Stillleben, das ganze Geschichten erzählen kann.
Bunt und themenreich zeigt der 1944 in Meseritz (heute Miedzyrzecz, Polen) Geborene und spätere Meisterschüler Günther Brendels, Walter Womackas, Kurt Robbels und Arno Mohrs an der Kunsthochschule Berlin die ganze Facette seines künstlerischen Schaffens. "Dank der Raumaufteilung des Museums konnte ich die Ausstellung nach Schaffensperioden ordnen", so Wolfgang Liebert, der eine Diskussion um die weitere Existenz des Museums überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das konnten auch die anwesenden Besucher nicht. Wolfgang Liebert fand sehr innige Worte des Dankes für Hartmut Preuß und wünschte ihm für sein Wirken und die zukünftige Entwicklung des Museums alles Gute. Das entspricht auch dem Lebensmotto des Malers, der die einzigartige Gabe besitzt, als außen stehender Beobachter mitten im Geschehen zu sein. Josta Tepasse (Humboldt-Uni Berlin) sagte über ihn: "Die Kunst hat Wolfgang Liebert auf die Spuren der Kulturen und auch Religionen geführt, zum Verständnis für Unterschiede und Gemeinsamkeiten und dadurch zur Toleranz, einer Lebenshaltung, die sich in jener Gelassenheit widerspiegelt, die es ihm ermöglicht, zum sensiblen Beobachter mit der notwendigen Distanz zu werden." Sein Werk "Eiszeit" verbleibt übrigens in Fürstenberg, soll aber nicht als Symbol für zukünftige Entwicklungen in punkto Kultur in Eisenhüttenstadt stehen.

PNN 10.11.2009 /// Heißer Herbst in Werder
Ausstellung mit Wendekunst aus Ost und West im Kunst-Geschoss ...
Werder (Havel) - In der Kulturstadt Werder ist zurzeit ordentlich was los. Zuerst eine Ton-und Kirschen-Premiere, dann die Eröffnung der Comédie Soleil, gleich darauf im „Kunst-Geschoss“ diese exzellente Ausstellung „Blick zurück nach vorn“ anlässlich von 20 Jahre Mauerfall. Kurator Frank ARATORA Weber, nach Bürgermeister Große „ein Glücksfall“ für die Stadt, fand diesen Titel im Gespräch mit der Filmemacherin Gitta Nickel, denn wie der Dramatiker John Osborne wollte man eben nicht „im Zorn“ zurücksehen.
Vor der Vernissage fand in der vollbesetzten Inselkirche eine Festveranstaltung mit dem ehemaligen sächsisch-anhaltinischen Ministerpräsidenten Reinhard Höppner und der Gruppe „Keimzeit“ statt, dann schien es, als ob der gesamte Haufen das Schützenhaus erobern wollte. Kurz, es war am Sonntagabend proppenvoll in der obersten Etage. Der stets ideenreiche Kurator hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Dort, wo Stadtverordnete sich versammeln, hängte er fünfzehn Fotos Werderaner Häuser rund ums Jubiläumsdatum auf den Flur. Wie sie (die Bauten!) heute aussehen, wird absichtlich nicht gezeigt, es wäre nur billig. In der Galerie selbst ist eine Abteilung für das Rahmenprogramm reserviert. Zur Eröffnung sah man eine halbe Stunde Videoaufnahmen aus der unmittelbarsten Wendezeit. Jeden Donnerstag gibt es hier kostenlose Filmvorführungen nebst Gespräch mit Gitta Nickel, Stefan Trampe, Rolf Losansky und Reinhard Holzhauer. Es wird auch ein Bildband von Martin Ahrends und dem Fotografen Joachim Liebe zum Thema vorgestellt. Das Wichtigste im „Kunst-Geschoss“ bleiben natürlich die Bilder. Auch hier eine wunderbare Idee: Frank Weber hat jeweils vier bildende Künstler aus „ehemals Ost“ und „ehemals West“, sowie mit Walter Lauche einen Übersiedler von West nach Ost als Partner seines Rückblickens gewonnen. Es handelt sich durchweg um Werke, die zwischen 1988 und jenem Jahr 1993 entstanden, als nach der Vision von Walter Lauche Deutschlands Schutzengel streikten: Macht selbst weiter!, schienen sie zu sagen. Wie sie verschwanden viele der gezeigten Bildwerke bald in Depots.
Zwanzig Jahre später führt ausgerechnet Werder sie ins öffentliche Bewusstsein zurück. Ob sie dabei wirklich „keine Kunst für die jüngere Generation“ sein können, wie Frank Weber meint, ist nicht nur ob ihrer erkennbaren Frische zu bezweifeln. Zerstörte diese These nicht sein schönes Ausstellungskonzept? Texttafeln berichten nun über Leben und Werk der Künstler, und wie diese Ausstellung „gemeint“ sei, deren „geografische Herkunft“ aber wird absichtsvoll verschwiegen. So kann Rolf Schuberts zurückkehrender Mose den Wendeleuten wie auch den Gegenwärtigen seine alten Steintafeln vorhalten, Wolfgang Liebert seinen Anonymus bei abnehmendem Mond von Bild zu Bild schicken, oder Heinz-Detlef Moosdorf in einem skurrilen Linolschnitt den „rot-schwarzen Säger“ wieder sägen lassen. Axel Gudrum machte den damaligen Imperativ „go west!“ zu einem Maskenzug im Renaissance-Stil. Johanna Schoenfelder probierte in einer Farbradierung vierundzwanzigmal, das Brandenburger Tor neu zu interpretieren. Wie doppelsinnig Günter Ihles „Die Kohle kommt“ werden sollte, kann man heute viel besser erkennen, damals verdüsterte noch echte Kohle das Stadtbild von Leipzig. Ernst Leonhardts „Grenzübergangsstelle“ soll außen vor nicht bleiben, noch weniger ARATORAS „Mitgift“ – besonders jenes 1988 im Auftrag der Evangelischen Kirche gemalte „Fenster mit Masken“, welches nach der Einheit an den Künstler zurückgegeben wurde. Dies und mehr ist auf dem real existierenden Sitzelement vom Palast der Republik wohl am besten zu bedenken.

MAZ 22.04.2008 /// Aprilschnee in Jasnaja Poljana
Galerie Ausstellung "Die Ferne ist so nah" von Wolfgang Liebert im Museum Alexandrowka ...
Ostern 1984 auf Leo Tolstois Landsitz Jasnaja Poljana in der Nähe Tulas. Aprilschnee hat die Apfelbäume, die der große russische Schriftsteller zum Teil noch selbst pflanzte, in einen zarten Schleier gehüllt.
Fasziniert von dem märchenhaften Anblick hat der Potsdamer Maler und Grafiker Wolfgang Liebert (63) des Dichters Apfelgarten damals mit dem Pinsel festgehalten. Das Bild ist in der Ausstellung "Die Ferne ist so nah" zu sehen, die gestern im Museum Alexandrowka eröffnet wurde. Die Exposition zeigt im Wechsel 30 Kunstwerke - vor allem Pastelle auf Velourpapier, eine Technik, die Liebert wegen ihres warmen, samtigen Tons besonders mag, aber auch einige Ölgemälde, die größtenteils von 1980 bis 1990 in der damaligen Sowjetunion entstanden.
Neben Tolstois Apfelgarten Motive, wie die Auferstehungskirche von St. Petersburg, Landschaften und abgelegene Dörfer in Karelien, zerfallene Fischerhütten. "Keine Porträts, aber Spuren, die der Mensch in Form von Bauwerken hinterlassen hat", sagt der Künstler, der die russische Seele ergründen wollte und das riesige Land schon seit 1970 zu verschiedenen Jahreszeiten bereiste. Lieberts Interesse wuchs mit der Kindheit. "Ich wohnte damals in der Rembrandtstraße, in der Nähe der Kommandantur, und wir Kinder kletterten oft in die Autos der sowjetischen Offiziere und unterhielten uns mit ihnen mit Händen und Füßen", erzählt der Potsdamer. Als Jugendlicher beeindruckten ihn die Bücher Gogols, Tolstois und Turgenjews, aber auch Filme, wie "Der stille Don" und "Die Kraniche ziehn".
Besonders fasziniert aber hat ihn die Lebenseinstellung der Menschen. "Sie sehen sich als ein Teil der Natur, nicht als ihr Beherrscher. Und durch diese Demut der Natur gegenüber entsteht eine innere Ruhe und Gelassenheit. Die Menschen sind sehr warmherzig und besitzen die Fähigkeit, mit Wenigem auszukommen und das Beste daraus zu machen". Wolfgang Liebert, der an der Kunsthochschule Berlin Weißensee studierte, seit 1969 an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt war, hat ab 1973 freischaffend gearbeitet. Er lehrte an der Fachschule für Werbung und Gestaltung und nach der Wende an der Fachhochschule Potsdam. Heute ist er als freier Maler tätig. Zurzeit beschäftigt er sich mit dem Thema "Endlichkeit der menschlichen Existenz". "Ars longa - vita brewe", "Die Kunst ist lang, das Leben kurz" ist das Credo für mich, sagt Liebert.

MAZ 07.09.2009 /// Caputher Eseleien
Bilder von Magnus Zeller und Schülern seines Malzirkels im Fährhaus …
Schwielowsee – Für die fortgeschriebene Geschichte der „Havelländischen Malerkolonie“ sicher ein Segen, für den Galeristen Norman Müller eher ein Wagnis, zeigt sich die neue Ausstellung in der Kunstremise am Fährhaus Caputh seit dem Wochenende lokalpatriotisch. Es hat nicht besonderer Künste von Helga Helm gebraucht, ihn zu überzeugen, doch mal Werke ihres Vaters Magnus Zeller (1888-1972) und seines 1962 gegründeten „Mal- und Zeichenzirkels Caputh“ auszustellen. Was mag aus seinen Mitgliedern geworden sein? Wie bei Christian Heinze in Potsdam, gingen ja auch aus diesem Zirkel namhafte Künstler hervor. Einerseits können sich die Besucher über die bis in die zwanziger Jahre zurückreichenden Arbeiten von Zeller freuen, über den frech-melancholischen „Leeren Zirkus“ (1925) oder die politisch anzügliche „Hundebalgerei“ von 1937. Andererseits werden sie auf Namen wie wie Wolfgang Liebert, Peter Fritz und Manfred Butzmann aufmerksam gemacht, alle drei im Kriege geboren und hierzulande nicht unbekannt. Peter Fritz stammt aus Werder, war 1963 unter Zellers Fittichen, hat es mit seinen Sachen dann bis in die internationale Kunstszene geschafft. Von ihm sind impressionistische Landschaftsbilder der letzten Jahrzehnte in Öl ausgestellt. Watt, Marschen, die Farbenpracht der Uckermark, wohin er sich zurückzog, haben alle einen gewissen Grad an Unschärfe. Dort malte er wohl auch diese prachtvolle „Abendwolke“ von 1997. Manfred Butzmann, ein Potsdamer, hielt es eher mit Stadtlandschaften.
Auf zwei Farboffset-Lithos sieht er „dunkle Flecken“ an Häuserwänden, Schatten am Giebel, sein Bild „Anhalter Puff“ in Halle zeigt ein rosa Haus, beim zweiten Hinsehen – das war wirklich so – ergab sich in dieser Düsterstraße die Farbfolge Schwarz-Rot-Gelb. Das sind vielleicht Sachen! Wolfgang Liebert gehörte fast noch zu den Gründungsmitgliedern des Zellerschen Zirkels. Er hat sich zum Sujet-Konstrukteur einer unverwechselbaren Bildsprache entwickelt, Montiertes aus dem finsteren Sack der Antike setzt er neben Gegenwärtiges. So ist das wohl auch gemeint. Einige Figuren wie „Amor und Psyche“ erinnern in ihrer konstruktivistischen Formreduktion an Hans Ticha. Allen dreien darf man – falls notwendig – eine gediegene künstlerisch-ästhetische Ausbildung bestätigen. Auch Magnus Zeller dürfte da seinen Anteil haben. Aber es genügt auch, auf den zunehmend professionellen Blick des Galeristen hinzuweisen. Er bestätigte Caputh in der Sommermitte einen radikalen Austausch des Publikums, „da kommen ganz andere Leute“. Und sagt zugleich, daß ihm die Einheimischen immer wichtiger werden. Deshalb vielleicht auch das schnelle Ja zu dieser beispielhaften Ausstellung, der Mut zu einer ersten Grafik-Schau in der Remise. Während Wolfgang Liebert noch 2001 über seinen „Ikarus“ brütet, schaut man voller Freude auf die zeitloser werdende Grafik des Altmeisters. Ist die Welt nicht ein Zirkus, sitzt da nicht ein deutscher Künstler auf dem Esel?

23.06.2008 /// Hochgeschätzt
Im Gespräch: Schüler von Suse Globisch-Ahlgrimm …
Waldhornklänge begrüßten den Besucher, der am Samstagnachmittag den Pfingstberg erklomm. Ein Hornquartett erfreute die Ausflügler auf der Wiese und war gerade rechtzeitig mit seinem Programm fertig, um die Finissage zur Ausstellung „Feldblumen Jakobsleiter“ der Potsdamer Malerin und Kunsterzieherin Suse Globisch-Ahlgrimm nicht zu „stören“. Denn die fand unter der blau-weiß-gestreiften Markise auf dem Dach des Pomonatempels statt: dicht neben grünen Baumkronen und einem wunderbaren Panoramablick. Lebhaftes Vogelgezwitscher inklusive. Der Potsdamer Kunstverein, dem die hochbetagte Künstlerin selbst angehört, hatte zum Künstlergespräch geladen, das vom Kurator der Ausstellung Thomas Kumlehn moderiert und vom Grafiker Manfred Butzmann und der Kunsterzieherin Heidi Wilhelm bestritten wurde. Nicht allein, denn weitere Schüler, unter ihnen die Maler Wolfgang Liebert und Peter Fritz sowie die Malerin und Keramikerin Elke Bullert waren ebenfalls zur Finissage gekommen. Sie alle hatten die in Potsdam noch heute hochgeschätzte Lehrerin selbst als Schüler in den 50er und 60er Jahren am heutigen Helmholtz-Gymnasium erlebt und ließen sich nicht lange bitten, von ihren Begegnungen mit Suse Globisch-Ahlgrimm zu erzählen. Heidi Wilhelm, die die verehrte Lehrerin 1977 als Kunsterzieherin am Helmholtz-Gymnasium „beerbte“, hat diesen Schritt sehr bewusst getan. Sie gestand, noch lange Zeit von den alten Mitschriften aus Ahlgrimms eigenem Unterricht profitiert zu haben, in dem sie sie für die eigenen Vorbereitungen verwendete. Denn Ahlgrimm hatte nicht nur das Mittelalter und die Moderne, die im offiziellen Lehrplan „gestrichen“ waren, unterrichtet, sondern ihren Schülern vor allem Herz und Augen geöffnet.
Das passierte nicht nur im wunderbar zweckmäßig eingerichteten Zeichenraum der Schule, sondern oft auf Exkursionen in die freie Natur oder zu architektonischen Kleinoden, von denen auch andere Zuhörer aus dem Publikum schwärmten.
Ins Schwärmen gerieten auch Wolfgang Liebert und Manfred Butzmann. Ersterer hat noch eine dicke Kunstmappe im Besitz, auf die Suse Ahlgrimm damals sehr großen Wert legte. Butzmann berichtete sowohl von den Fähigkeiten der Lehrerin, Fäden und Freundschaften zwischen verschiedenen Schülerjahrgängen – die noch heute halten – zu spinnen und zu knüpfen, als auch von ihren Versuchen, ihn selbst zu motivieren, den ungeliebten Lateinunterricht nicht zugunsten der Malerei zu vernachlässigen. Für das nötige Selbstbewusstsein, sich für ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee zu bewerben, hatte sie ohnehin längst den Grundstein gelegt. Moderator Thomas Kumlehn, der seit 2005 den Nachlass ihres Mannes Hubert Globisch betreut, richtete herzliche Grüße der gerade 88 Jahre alt Gewordenen aus und berichtete, dass sie auch heute noch sehr wach die neuesten Kunstentwicklungen zur Kenntnis nehme. Ihre gerade zu Ende gegangene eigene Ausstellung im Pomonatempel zeigte Miniaturen aus den vergangenen drei Jahren, die auf wunderbare Weise einen Bogen zwischen ihrem Früh- und Spätwerk spannen. Besonders berührend zu lesen war dabei auch eine handschriftliche Notiz über eigene Unsicherheiten beim Prozess des Malens.

MAZ 06.05.2008 /// Zwischen Knoblauch und Banja
Der Potsdamer Maler Wolfgang Liebert stellt im Museum Alexandrowka seine Russland-Bilder aus …
Die Ferne ist so nah. Besonders in Potsdam. Wer zur Alexandrowka spaziert, fühlt sich plötzlich nach Russland verschlagen. Noch immer vermeint man, die Akkorde der eingewanderten Sänger zu vernehmen, die einst in diesen Holzhäusern lebten. Die stimmungsvolle Malerei von Wolfgang Liebert fühlt sich im Gleichklang mit dieser viel beschriebenen russischen Seele. Die 30 Pastelle und Ölbilder, die der Potsdamer Künstler derzeit im Museum Alexandrowka ausstellt, atmen zufriedene Beschaulichkeit, die Idylle in der Unvollkommenheit. Auf seinen Reisen durch das Land von Tolstoi und Dostojewski, die er in den 70er und 80er Jahren unternahm, suchte der 1944 geborene Maler das Verborgene: eine Ahnung vom Miteinander in der einfachen, dörflichen Lebenswelt. Obwohl menschenleer, ahnt man, was sich hinter den schrägen Bretterwänden der Datschen und Hütten zugetragen haben könnte. Die saftig dicken Knoblauchknollen auf dem Fensterbrett erzählen von der Eigenversorgung aus dem Garten, die selbstgebauten Antenne auf dem Dach vom Talent des Improvisierens, die aufgestapelten Holzscheite vom Schwitzen in der Banja. Die windschiefen Behausungen scheinen förmlich aus dem Wald herauszuwachsen. Kaum Himmel, dafür eine dichte grüne Kuppel. Liebert malte seine Pastelle auf Velourpapier und tauchte sie damit in eine samtige Wärme. Das Licht verfängt sich spielerisch im Dickicht. Gern verweilt man in diesem Karelien, das beim Blick aus dem Museumsfenster auch vor der Haustür liegen könnte. Im zweiten Raum der kleinen Ausstellung wird das ruhige Verweilen in den Bildern etwas aufgeschreckt. Zu dicht hängen die Werke, die neben der dörflichen Abgeschiedenheit auch das städtische Leben reflektieren. Unter einer Dunstglocke liegt St. Petersburg, riesige Schornsteinschlote ragen wie Zeigefinger in die Höhe. Tolstois Apfelgarten zeigt seinen bizarren Charme noch unter Schnee, lässt aber den Frühling erahnen. Der Blick hinaus auf die Apfelbäume der Alexandrowka gibt indes bereits eine weiße Blütenpracht preis. Es ist ein spannendes Schauspiel, mit den Augen zwischen Drinnen und Draußen zu flanieren.
„Wir nehmen in unseren Wechselausstellungen gern Bezug zur Kolonie und zu Russland“, sagt Museumsleiter Tim Esser. Er leistet sich den kleinen Luxus, alle Schauen mit eigenen Katalogen zu begleiten, die noch tiefer in die Bilderwelten eindringen lassen. Auch für die nächste Ausstellung liegt bereits einer vor: Nach der besinnlichen Atmosphäre, die Wolfgang Liebert herauf beschwört, warten ab 25. Mai die surreal-absurden Fantasien Michail Bulgakows auf den Betrachter. Sein berühmter Roman „Der Meister und Margarita“ wird in den Radierungen von Thomas Kateloe auf subtile Weise aufgeblättert und mit spitzem Stift interpretiert. In eine recht schlüpfrige Geschichte wird der Besucher in den Sommermonaten verwickelt: Bei einem forschenden Blick in die Vergangenheit der Russischen Kolonie stieß Architekt Thomas Sander auf einen Brand um 1850 sowie auf ein dubioses Gerichtsverfahren. Zwei Soldaten aus Potsdam verführten in einem der Holzhäuser einen Mann in Frauenkleidern. Entrüstet angesichts dieser Täuschung gingen sie in Berlin vor Gericht und erreichten, dass „die falsche Schöne“ wegen Betrugs ins Gefängnis musste. Während der Abwesenheit kam es zum Brand im Haus des Inhaftierten. Die Ausstellung möchte das Leben dieses Transvestiten näher beleuchten und dabei auch das Innere eines Holzhauses der damaligen Zeit simulieren. Tim Esser ist bereits dabei, per Computervisualisierung das Interieur dreidimensional einzufangen. Auch der Mann in Frauenkleidern wird zu sehen sein: „allerdings mit der nötigen Unschärfe, denn es ist kein definierter Charakter überliefert.“Vorerst geht es aber noch friedlich zu, bringt uns Wolfgang Liebert die Ferne nah, auch wenn die Zeitläufe inzwischen vielleicht ganz neue Töne angeschlagen haben.

PNN 23.05.2008 /// Kaschubien hinter der Foersterbank
Wolfgang Liebert sowie historische Gartenbänke im Haus zum Güldenen Arm
In Potsdam hat der Spaziergänger vielfach Gelegenheit dazu: Er kann sich auf einer Bank niederlassen, um in Ruhe und mit Genuss die gestaltete Kulturlandschaft zu betrachten. Ganz gleich, ob er sich dabei auf einer der steinernen halbrunden an der Großen Fontäne oder auf einer grünen Holzbänke im Marlygarten niedersetzt, bei den meisten Betrachtern steht vermutlich die dabei zu genießende Aussicht im Vordergrund des visuellen Vergnügens.
Und doch bieten vor allem historische Gartenbänke nicht nur für Kenner ein eben solches Gefühl. In der neuen Doppelausstellung im Museumshaus "Im Güldenen Arm", die Baubeigeordnete Elke von Kuick-Frenz zum diesjährigen Saisonstart eröffnete, kann man beides miteinander verbinden. Der bekannte Maler und Grafiker Wolfgang Liebert präsentiert dort Potsdamer Veduten aus vierzig Jahren und Peter Herling, bis 2001 Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde, hat hier erstmalig historische-Gartenbänke aus den letzten hundert Jahren aus Potsdam und Berlin zusammengetragen und inmitten von Lieberts Landschafts- und Städtebildern aufgestellt. Zu erleben ist eine anregende und überraschende Synthese aus Landschaftsmalerei und Sitzmöbelarchitektur.
So findet der Besucher hier eine eindrucksvolle weiße Gartenbank mit überaus schwungvoll gestalteter Rückenlehne und dem Namen "Ostramonda", die sonst in einem Vorgarten in der Clara-Zetkin-Straße zu finden ist, plötzlich inmitten von Ölgemälden mit Ansichten des antiken Pompeij oder dem Blick auf "Eugenischen Hügel" in Venezia wieder. Die berühmte "Foersterbank", auf der Vater Wilhelm mit seinen Söhnen Friedrich Wilhelm und Karl einstmals entspannt nebeneinander saß, gibt nun den Blick auf Kaschubische Landschaften, bäuerliches Scheuneninterieur oder eine wunderbar blaue Augustnacht in der Kindheitslandschaft des 1944 in der damaligen Grenzmark geborenen Malers frei. Aber auch die bekannte "Lindenbank" des Metallbildhauers Fritz Kühn, eine gelungene Synthese aus Funktion und sicherem Gefühl für Material und Form, und, damit einer der wenigen ausgereiften Designstandards der ehemaligen DDR, ist jetzt im Erdgeschoss des Museumshauses in der Herman-Elflein-Straße wieder zu entdecken. Gleiches gilt für inzwischen verschwundene oder restaurierte Teile der Potsdamer Innenstadt. Wolfgang Liebert, zu dessen frühen Anregern Susanne Ahlgrimm und Magnus Zeller zählten, der seinen Blick jedoch immer wieder vorzugsweise an Paul Cezanne schulte, hat auf seinen Bildern Ende der 80er Jahre viele Gebäude festgehalten, die heute so oder überhaupt nicht mehr existieren. Beispielsweise die für den Maler wunderbar morbiden Abrisshäuser in der Gutenberg- oder Jägerstraße, oder auch das alte Potsdamer Gaswerk in der Schiffbauergasse von 1963, wo seit vergangenem Jahr das neue Theater mit der ehemaligen Zichorienmühle als Restaurant steht.
Seit der Antike spielen Bänke eine wichtige Rolle für die Gestaltung von Gärten und Parks, hob Stadtkonservator Andreas Kalesse zur Ausstellungseröffnung hervor. Und als höchstes ästhetisches Gestaltungskriterium für deren Erbauer stellte er mit der Frage, ob ein Maler solch ein Sitzmöbel verewigen würde, den direkten Bezug zur bildenden Kunst her.
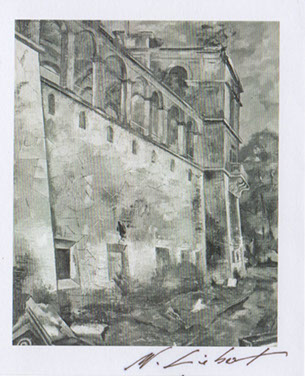
MAZ 16.12.2004 /// Kein Heute Ohne Gestern
Kunst bei der IHK: Der Potsdamer Maler und Grafiker Wolfgang Liebert mit 60 Arbeiten bis Ende März im Stammhaus in der Breiten Straße in Potsdam.
,,Ich habe die Reste der Garnisonkirche noch gezeichnet, bevor sie weggesprengt wurden.'' Das sagt der Potsdamer Wolfgang Liebert, dabei umspielt ein kaum merkliches Lächeln seine Mundwinkel. ,,Jetzt will man sie wieder aufbauen und tut sich doch so schwer damit.''
Liebert, 1944 in Meseritz in der Grenzmark geboren und erst 1951 nach Potsdam gekommen, fühlt sich heute den geschichtlichen und kulturhistorischen Traditionen Potsdams verpflichtet. ,,Nein'', das sei richtig, Preußen gebe es nicht mehr. Aber das Erbe. Schließlich hätte man ohne das Gestern kein Heute und schon gar kein Morgen.
Liebert, den die stetige Beschleunigung des jetzigen Lebens nachdenklich stimmt, nimmt sich die Zeit. Er fährt regelmäßig nach Italien, spürt dort neben der eigenen auch die Verwandtschaft preußischer Ideale auf. ,,Friedrich des Großen Beziehungen zur Antike, die Liebe zum Frühklassizismus von Friedrich Wilhelm II., die Synthese von Architektur, Malerei und Gartengestaltung unter Friedrich Wilhelm IV.- all das hat unsere Region geprägt.'' Nun gelte es, dies zu bewahren, so Liebert. So spielen die Antike, Italien, Potsdams Parks und Schlösser aber auch die Innenstadt ihre Rollen in seinen Werken.
Der ehemalige,,Helmhöltzer'' - er absolvierte an dem traditionsreichen Potsdamer Gymnasium, das damals Erweiterte Oberschule hieß, sein Abitur - studierte Malerei und Grafik an der Kunsthochschule in Berlin Weißensee, arbeitete zwölf Jahre freischaffend, lehrte ab 1985 als Fachschullehrer an der Fachschule für Werbung und Gestaltung Potsdam, sowie an der später gegründeten Fachschule für Werbung und Gestaltung Potsdam und an der später gegründeten Fachhochschule bis 1996. Bis 2004 war er bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg im Besucherservice tätig.


WOLFGANG LIEBERT
Stand: April 2022 | © Wolfgang Liebert | Maler und Grafiker | Impressum | Datenschutz